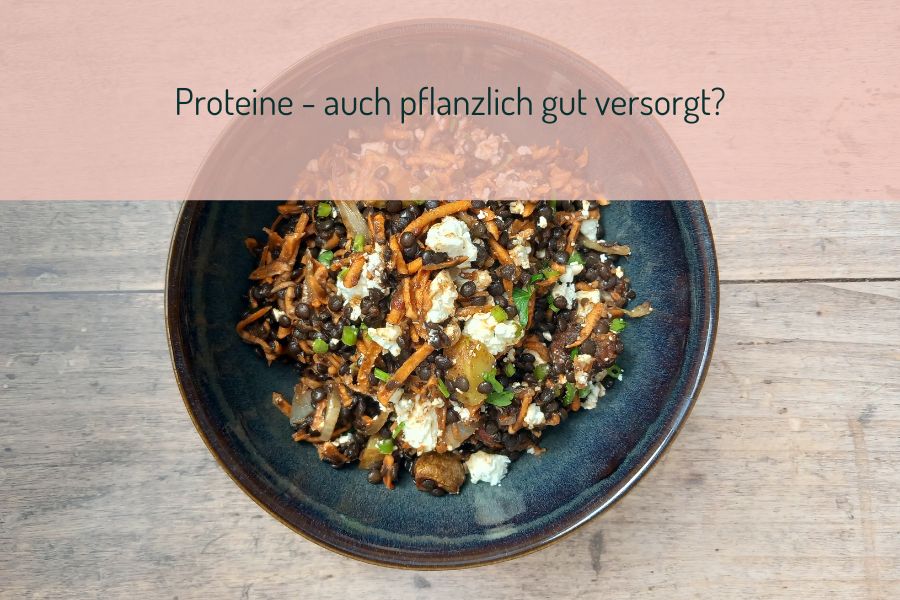
Proteine - auch pflanzlich gut versorgt?
Immer mehr gesundheits- und umweltbewusste Menschen reduzieren Fleisch, Wurst und Milchprodukte, ersetzen diese aber nicht unbedingt durch hochwertige pflanzliche Proteinquellen. So simpel uns das erscheint, in der Realität scheint es dann doch nicht so einfach zu sein. Wie eine bedarfsgerechte Zufuhr bei höherem pflanzlichen Anteil gelingt.
Weniger tierisch, mehr pflanzlich
Ernährungssysteme sind weltweit für etwa ein Drittel aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Auch für Österreich werden die THG-Emissionen, die durch den Ernährungssektor in Summe verursacht werden, mit ca. 20-30 % beschrieben [1]. Aus diesem Grund wurden bei der Aktualisierung der nationalen lebensmittelbasierten Ernährungsempfehlungen erstmals neben Nährstoffempfehlungen und Aspekten der Krankheitsprävention auch Umwelt- und Klimaparameter berücksichtigt [2].
Die Produktion tierischer Lebensmittel verursacht wesentlich höhere Treibhausgasemissionen als jene pflanzlicher. Daher setzen die aktualisierten Empfehlungen nun verstärkt auf Hülsenfrüchte – also Linsen, Bohnen, Soja, Kichererbsen oder Erbsen – als neue, hochwertige Proteinquelle. Auch aus Hülsenfrüchten hergestellte Produkte wie Tofu oder Tempeh zählen dazu.
Während einige Verzehrempfehlungen bei omnivoren und vegetarisch lebenden Personen unverändert geblieben sind, gelten nun folgende neue Empfehlungen für bestimmte Lebensmittelgruppen, die auch separat zu berücksichtigen sind [3].
Omnivore Ernährungsweise mit Fleisch und Fisch:
- weniger Fleisch und Fleischprodukte, zusätzlich Fisch (ca. 150 g pro Portion, in reduzierter Häufigkeit max. 3 pro Woche, davon 1 x Fleisch, 1 x Fisch und 1 x Fleisch oder Fisch)
- weniger Milch/Milchprodukte (neu 2 Portionen täglich statt bisher 3)
- 3 Eier pro Woche (gleich geblieben)
- mehr pflanzliche Proteine: neu mind. 3 Portionen Hülsenfrüchte à 125 g (gekocht) pro Woche
Vegetarische Ernährung ohne Fleisch und Fisch:
- 3 Portionen Milch/Milchprodukte täglich (höher als omnivor)
- 4 Eier pro Woche (höher als omnivor)
- mind. 4 Portionen Hülsenfrüchte pro Woche (höher als omnivor)
Fokus auf hochqualitativer Proteinversorgung
Es dreht sich bei genauerer Betrachtung also Vieles um die umfassende und qualitative Versorgung mit Protein. Qualitativ hochwertige Proteine bzw. Aminosäuren sind wichtig für den Aufbau und Erhalt struktureller Gewebe und die Regulation zahlreicher metabolischer sowie hormoneller Prozesse. Werden nun Fleisch, Wurst, Topfen und Käse eher reduziert, sind andere Proteinquellen unerlässlich, um die empfohlene Menge und Qualität zu erreichen. Während uns Gemüse und Obst zahlreiche wertvolle Inhaltsstoffe wie Ballaststoffe oder sekundäre Pflanzenstoffe liefern, die in tierischen Lebensmitteln kaum vorkommen, können sie beim Proteinbedarf leider nicht mithalten.
Hülsenfrüchte: aktueller Stellenwert in Österreich
Derzeit essen Österreicher:innen im Schnitt deutlich weniger Hülsenfrüchte als empfohlen [4].
- IST: weniger als 1 Portion pro Woche (ca. 1,4 kg pro Kopf und Jahr)
- SOLL: mind. 3 Portionen pro Woche für Omnivore (ca. 20 kg pro Kopf und Jahr)
Damit bleibt viel Luft nach oben – und ein enormes Potenzial für Gesundheit und Nachhaltigkeit. Eine erfreuliche Nachricht: Der Selbstversorgungsgrad für Hülsenfrüchte liegt in Ö bei 78 %, das heißt, ein großer Teil davon kann auch regional abgedeckt werden [4].
Wie viel Protein braucht der Mensch?
Der Proteinbedarf gesunder, normalgewichtiger Personen liegt im Alter von 15 bis 65 Jahren bei 0,8 g Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Eine 60 kg schwere Person benötigt also rund 48 g Protein täglich. Eine 90 kg Person 72 g täglich. Für männliche Jugendliche, Menschen über 65 Jahren sowie schwangere und stillende Frauen gelten höhere Werte.
Erwachsene Breitensportler:innen (4–5 Mal je Woche 30 Minuten körperliche Aktivität bei mittlerer Intensität) benötigen laut DGE keine erhöhte Proteinzufuhr [5].
Proteinqualität beurteilen
Neben der Menge an aufgenommenen Proteinen ist besonders für vegetarisch oder vegan lebende Personen die Qualität der Aminosäuren sowie deren Verdaulichkeit und Aufnahme aus dem Darm bedeutend.
- Nicht alle Proteine sind gleich. Proteine pflanzlicher und tierischer Herkunft unterscheiden sich in der Zusammensetzung und Bioverfügbarkeit der Aminosäuren. Die Biologische Wertigkeit gibt an, wie effizient Nahrungsprotein in körpereigenes Protein umgewandelt wird. Durch die gezielte Kombination unterschiedlicher Lebensmittel wie z. B. Getreide mit Hülsenfrüchten steigt die Wertigkeit deutlich. Beispiele sind ein Linseneintopf mit Knödeln oder die bei Kindern beliebte Beilage Risipisi. Aber auch ein Brot mit Bohnenaufstrich versorgt uns optimal.
- DIAAS (Digestible Indispensable Amino Acid Score) ist eine Bewertungsmethode, mit der die Proteinqualität genauer bestimmt werden kann. DIAAS bestimmt die Aminosäureverdaulichkeit am Ende des Dünndarms und liefert so ein genaueres Maß für die vom Körper aufgenommene Aminosäuremenge und den Beitrag des Proteins zum menschlichen Aminosäure- und Stickstoffbedarf. Die FAO empfiehlt, die DIAAS Werte zur Beurteilung von Protein für die menschliche Ernährung heranzuziehen [6].
Beispiele für den Proteingehalt pro Portion:
- 150 g mageres, gegartes Fleisch: ca. 30 g
- 125 g Tempeh: 23 g
- 125 g Tofu: 13 g
- 125 g gekochte Linsen oder Bohnen: ca. 12 g*
- 125 g gekochte Sojabohnen: ca. 18 g
- 50 g Haferflocken: ca. 6 g
- 50 g Buchweizen: ca. 5 g
- 1 mittelgroßes Ei: ca. 7 g
- 150 g Naturjoghurt: ca. 6 g
- 100 g Topfen: ca. 11 g
- 100 g Skyr: ca. 10 g
- 100 g Teigwaren gekocht: ca. 5 g
*Für Hülsenfrüchte werden pro 100 g oft höhere Werte (ca. 25 g) angegeben, diese gelten aber nur für die getrockneten Varianten. Sobald diese für den Verzehr gekocht werden (müssen), schrumpft der Proteingehalt auf die Hälfte oder sogar auf ein Drittel.
Fazit: Nicht nur weglassen – auch sinnvoll ersetzen
Viele Menschen möchten tierische Produkte aus gesundheitlichen, ökologischen und/oder Tierwohlgründen reduzieren. Dabei wird aber schnell übersehen, dass ein Weglassen allein durchaus zu einer Unterversorgung an Protein führen kann, vor allem, wenn zusätzlich Milchprodukte vermieden werden.
Auch werden die Verträglichkeit mit Blähungen oder Vorurteile gegenüber Hülsenfrüchten häufig genannt, warum diese nicht regelmäßig verzehrt werden. Es braucht also Wissen zu Inhaltsstoffen und zur Zubereitung, eine Angewöhnung, aber auch Achtsamkeit und etwas Übung, um hochwertige Proteinquellen in unserer Ernährung einzuplanen. Und natürlich positive kulinarische Erfahrungen, um eine alte Gewohnheit überhaupt verändern zu wollen. Was nicht schmeckt, wird nicht gegessen.
Praktische Tipps für den Alltag
Tipp 1: Altbewährtes neu gedacht
Man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Lieblingsgerichte funktionieren meist auch gut als pflanzliche Variante.
- Chili sin Carne mit Bohnen statt Faschiertem
- Spaghetti mit Linsenbolognese oder
- Schokomousse aus Seidentofu.
Bei diesen beliebten Gerichten ist die Akzeptanz meist gut.
Tipp 2: Gut kombinieren und ergänzen
- Knuspriges Walnussbrot mit würzigem Hummus
- Pikanter Kichererbseneintopf mit Duftreis
- Sojajoghurt mit knackigen Nüssen und Haferflocken - all das sind köstliche, optimale Kombinationen von Proteinquellen.
Um wirklich auf 4 Portionen Hülsenfrüchte pro Woche zu kommen, ist es sinnvoll, sie möglichst oft als Zutat einzuplanen. Rote Linsen können als Bindemittel für Eintöpfe und Suppen statt Mehl oder Maisstärke verwendet werden, diese einfach mit kochen, sie zerfallen vollständig.
Tipp 3: Langsam steigern
Statt direkt auf 4 Portionen zu springen, ist es erfolgversprechender, den Hülsenfrüchteanteil in kleinen Schritten, dafür langfristig zu steigern. Als Beispiel: Über zwei Monate hinweg einmal pro Woche Hülsenfrüchte oder ein Produkt daraus in die Ernährung einbauen. Erst, wenn dies gut gelingt, weiter erhöhen.
Tipp 4: Blähungen gezielt reduzieren
- Die Wirkstoffe in Bohnenkraut, Kümmel und Majoran können helfen, Blähungen zu verringern. Sie passen auch geschmacklich hervorragend dazu.
- Hülsenfrüchte vor dem Kochen gut abspülen, sowohl als Trockenware, als auch aus der Konserve. Damit werden blähende saponinhaltige Stoffe an der Oberfläche zusätzlich reduziert.
Fotocredit: aFicala
Quellen und weiterführende Informationen
[1] APCC (2018). Osterreichischer Special Report Gesundheit, Demographie und Klimawandel (ASR18). Austrian Panel on Climate Change (APCC), Verlag der OAW, Wien, Osterreich, 978-3-7001-8427-0. Verfügbar unter: https://austriaca.at/APCC_ASR18.pdf
[2] Sturm L, Klausmann L, Seper-Nagl K, Alber O, Griesbacher A, Wagner K-H et al. Gesunde und ökologisch nachhaltige omnivore und ovo-lacto-vegetarische Ernährungsempfehlungen für Österreich - Entwicklungsprozess und wissenschaftliche Ergebnisse: AGES; BMSGPK; GÖG; 2024 [Stand: 08.01.2025]. Verfügbar unter: https://www.ages.at/forschung/wissen-aktuell/detail/aktualisierung-und-erarbeitung-der-omnivoren-bzw-ovo-lacto-vegetarischen-ernaehrungsempfehlungen-fuer-oesterreich
[3] Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Österreichische Ernährungsempfehlungen NEU; 2024 [Stand: 12.09.2024]. Verfügbar unter: https://www.sozialministerium.gv.at/Themen/Gesundheit/Ern%C3%A4hrung/%C3%96sterreichische-Ern%C3%A4hrungsempfehlungen-NEU.html
[4] Statistik Austria. Hülsenfrüchte: Pro Kopf Verbrauch in kg sowie Selbstversorgungsgrad in % 2023/34. Verfügbar unter: https://www.statistik.at/statistiken/land-und-forstwirtschaft/landwirtschaftliche-bilanzen/versorgungsbilanzen
[5] König D, Carlsohn A, Braun H, Großhauser M, Lampen A, Mosler S, Nieß A, Schäbethal K, Schek A, Virmani K, Ziegenhagen R, Heseker H: Proteins in sports nutrition. Position of the working group sports nutrition of the German Nutrition Society (DGE). Ernahrungs Umschau 2020; 67(7): 132–9. Verfügbar unter: https://www.dge.de/fileadmin/dok/wissenschaft/positionen/EU07_2020_M406_M413_1.pdf
[6] FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO); Rome. Food and Nutrition Paper (2013): Dietary protein quality evaluation in human nutrition. Verfügbar unter: https://www.fao.org/ag/humannutrition/35978-02317b979a686a57aa4593304ffc17f06.pdf
Kompendium Hülsenfrüchte; Kompetenzzentrum für Ernährung (KErn): 2018. Verfügbar unter:
https://www.kern.bayern.de/mam/cms03/shop/kompendien/dateien/kompendium_huelsenfruechte_r.pdf
Kommentare